Inhalt: Zur leichteren Navigation
sind die einzelnen Geschichten als Links
ausgeführt!!!
-
Wild-West
in Arenberg
-
Der
Schwarzmarkt
Die Franzosen kommen
-
Mein
erstes Radio
Schnapsbrennen
in Arenberg
-
Pflanzkartoffeln
aus der Pellenz
-
Beim
Apfelpflücken
-
Bucheckern,
Retter in der Not
Die
Nachkriegszeit
Vorbemerkung: In den
nachfolgenden Geschichten wird von
Amerikanern, Franzosen, Polen und den
damals teilweise angespannten
Beziehungen unter den Nationalitäten
berichtet. Die hier vorgestellten
Geschichten sind subjektive
Erinnerungen und Erzählungen aus der
damaligen Zeit. Sie stehen für sich
und geben nicht etwa meine heutigen
Einstellungen zu den jeweiligen
Nationalitäten wieder.
Konrad Weber im Jahr 2002
-
Am Dienstag
27. März 1945
war der Krieg auch für Arenberg
zu Ende, nachdem Koblenz schon
etwas früher von den Amerikanern
besetzt worden war. Damals lebten
nur noch etwa 4000 Personen in
der Stadt. Koblenz war ein
Trümmerhaufen, 1,5 Millionen
Kubikmeter Schutt und Trümmer
prägten das Stadtbild. Vom Rhein
hatte man ungehinderten
Durchblick bis nach Moselweiß.
Der Verlauf der Rheinstraße war
nicht mehr auszumachen, hier
lagen meterhoch die Trümmer der
zerstörten Häuser. Von den 7.370
Wohngebäuden im
Vorkriegs-Koblenz, waren 3.116
zerstört, die übrigen mehr oder
weniger stark beschädigt. Der
Bombenkrieg auf Koblenz hatte
1.016 Tote und 2.925 Verwundete
gefordert. Wie durch ein Wunder
blieben die großen
repräsentativen Bauten fast alle
erhalten, so das Rathaus, das
bisherige Oberpräsidium der
Rheinprovinz, das
Regierungsgebäude und das Hotel
Koblenzer Hof. Die Versorgung der
Stadt war total
zusammengebrochen, es gab weder
Strom, Kanalisation, Wasser noch
Gas. Die Eigentumsbegriffe waren
verwischt, es gab nichts zu
essen, es herrschte bittere Hungersnot. Jeder war sich selbst der
Nächste und war bestrebt,
notfalls mit kriminellen Methoden
über die Runden zu kommen. Die
Menschen suchten mit bloßen
Händen in den Trümmern nach noch
brauchbarem Hausrat oder
Konserven und hofften sonstige
persönliche Habseligkeiten zu
finden. Der Schwarzmarkt blühte.
Das Geld, die Reichsmark, war
nichts mehr wert. Für
Zigaretten konnte man dagegen
(fast) alles bekommen. Alle
Koblenzer Brücken waren zerstört.
An Stelle der alten Schiffsbrücke
bauten die Amerikaner eine
Pontonbrücke nach
Ehrenbreitstein, die in der Regel
nur mit Passierschein und
vorhergehender "Entlausung" mit
DDT Spritze in Ehrenbreitstein,
benutzt werden durfte. Die
Entlausungsspritze hatte
gigantische Ausmaße, etwa 50 cm
lang und 12 cm im Durchmesser,
oben mit einem Griff, ähnlich dem
einer Luftpumpe, unten mit
phallusartigem Gebilde am Ende,
aus dem die DDT-Staubwolke unter
Druck austrat. Man muss sich
einfach eine überdimensionierte
medizinische Spritze in brauner
Farbe vorstellen.
-
Die Männer mussten
sich bis auf die Unterhose
ausziehen und ein G.I. zog die
Unterhose am Bund an, der andere
nebelte den Genitalbereich ein.
Die Frauen durften den BH und den
Rock anbehalten, das übrige lief
gleich ab. Erst nach dieser
äußerst peinlichen Prozedur gab
es den Passierschein. Die G.I.´s*
machten sich aus dieser
"Entlausung" besonders bei den
Frauen in Scham verletzender
Weise einen derben Spass, oft
begleitet von feixenden
Kommentaren. Um dem
erniedrigenden Prozedere zu
entgehen, schickten Mütter oft
auch ihre Kinder. Die Schikane
diente meiner Einschätzung nach
nur der Demütigung der
Bevölkerung, die ohnehin in Not,
Hunger und Elend dahinvegetierte,
aber trotz allem nicht verlaust
oder verwahrlost war.
Ehrenbreitsteiner Jungen trieben
einen schwunghaften Handel mit
den Passierscheinen, gegen Bares
natürlich, indem sie sich
mehrmals am Tage entlausen
ließen. Die Entlausung war auch
die erste Hürde der
zurückströmenden, wegen des
Bombenterrors evakuierten
Koblenzer aus Thüringen, Sachsen
usw., die nach Koblenz, oftmals
zu Fuss zurückkamen, weil
öffentliche Verkehrsmittel und
die Eisenbahn zerstört waren oder
kein Treibstoff vorhanden
war.
-
-
* G.I.
government issue,
(Staatseigentum), früher Aufdruck
auf milit. Ausrüstung der amerik.
Armee, dann übertragen auf
amerik. Soldaten.
Zum
Seitenanfang
-
-
Wild-West in
Arenberg
-
Die Deinhard
Sektkellerei unterhielt in
Bürgermeister Peter
Klee´s Keller ein
Ausweichlager. Der Keller selbst
war zwei Stockwerke tief. Im
unteren Teil war das
Ausweichlager untergebracht. Hier
lagerten alte, edle Tropfen, das
wussten auch die in der
ehemaligen Flakkaserne
(Niederberger Höhe) internierten
polnischen Zwangsarbeiter. Sie
terrorisierten die hiesige
Bevölkerung und bedrohten sie mit
einer Axt, um Geld oder
Lebensmittel zu erpressen. In den
ersten Apriltagen 1945 plünderten
ca. 150 Polen Peter Klee´s
Keller, um sich an den
Deinhard´schen Edeltropfen zu
laben. Säckeweise mit Sekt- und
Champagnerflaschen beladen zogen sie
durch die Silberstrasse in
Richtung Flakkaserne. Wenige
Minuten später war amerikanische
MP (Militärpolizei) zur Stelle.
Sie sprangen aus den Jeeps und
postierten sich an der Einfahrt
zu Webers Hof in der Silberstraße. Einer lehnte sich
an die Mauer, Zigarette im
Mundwinkel, Kaugummi kauend und
eine leichte Maschinenpistole
unterm Arm, in 25 Meter
Entfernung tauchte ein Pole auf,
in jeder Hand eine kostbare
geschliffene Bouteille,
italienischer oder französischer
Herkunft mit rotem Inhalt, die im
Rhythmus der Vorwärtsbewegung hin
und herpendelten. Zwei kurz
aufeinanderfolgende Schüsse - die
Bouteillen fielen fast
gleichzeitig zu Boden - der Pole
sah sich verdutzt seine Hände an,
in denen nur noch der
Flaschenhals mit dem Korken
waren. Jetzt erst nahm er den
MP-Soldaten wahr, wurde bleich im
Gesicht und hatte nicht nur sprichwörtlich
die Hosen voll.
-
Carl May´s
Winnetou hatte ich gelesen und
kannte seinen "Knieschuss", aber
so etwas hatte ich bis dahin noch
nie gesehen. Ich war bei der
Hitlerjugend noch am "Karabiner"
ausgebildet, wir hatten über
"Kimme und Korn" zielen gelernt -
aber aus der Hüfte schießen und
auch noch treffen - das war
unglaublich.
-
Nun begann erst
die Treibjagd, die MP-Soldaten
feuerten von hinten in die Säcke,
ein Schuss genügte, um den
gesamten Inhalt
 hochgehen zulassen
(der Champagner und Sekt war ja
gut durchgeschüttelt). Die Polen
standen förmlich unter einer
Sekt-Dusche. Die Silberstrasse
stank nach Alkohol, wie eine
Kneipe nach einer ausgelassenen
Kirmes. Wir Kinder liefen aus
Neugier hinter den Amis her, um
zu sehen, was weiter geschah. Auf
der Strasse zur Flakkaserne
(Umgehungsstrasse), damals noch
mit tiefen Gräben rechts und
links der Strasse, versuchten die
Polen, in Höhe des
Heiligenhäuschens, über die
Felder zu flüchten. Das half
ihnen allerdings recht wenig,
denn die Amis feuerten aus dem
fahrenden Jeep aus 60-70 Metern
Entfernung, wie gesagt ein Schuss
pro Sack, eine meterhohe Fontäne
stieg auf und zugleich
erleichtert und erfrischt rannten
die Polen weiter, wurden aber von
nachfolgenden Jeep´s
eingesammelt. Binnen kurzer Zeit
war der ganze Spuk vorbei. Vorbei
war auch der Terror der
polnischen Zwangsarbeiter, sie
wurden nach Hause, nach Polen
verfrachtet. hochgehen zulassen
(der Champagner und Sekt war ja
gut durchgeschüttelt). Die Polen
standen förmlich unter einer
Sekt-Dusche. Die Silberstrasse
stank nach Alkohol, wie eine
Kneipe nach einer ausgelassenen
Kirmes. Wir Kinder liefen aus
Neugier hinter den Amis her, um
zu sehen, was weiter geschah. Auf
der Strasse zur Flakkaserne
(Umgehungsstrasse), damals noch
mit tiefen Gräben rechts und
links der Strasse, versuchten die
Polen, in Höhe des
Heiligenhäuschens, über die
Felder zu flüchten. Das half
ihnen allerdings recht wenig,
denn die Amis feuerten aus dem
fahrenden Jeep aus 60-70 Metern
Entfernung, wie gesagt ein Schuss
pro Sack, eine meterhohe Fontäne
stieg auf und zugleich
erleichtert und erfrischt rannten
die Polen weiter, wurden aber von
nachfolgenden Jeep´s
eingesammelt. Binnen kurzer Zeit
war der ganze Spuk vorbei. Vorbei
war auch der Terror der
polnischen Zwangsarbeiter, sie
wurden nach Hause, nach Polen
verfrachtet.
-
Zum
Seitenanfang
-
-
Der Schwarzmarkt
-
Vor der Währungsreform konnte man
nichts für das wertlose Geld (RM
Reichsmark) kaufen. Für
Zigaretten, Kaffe oder Schinken
bekam man auf dem "Schwarzmarkt"
aber alles. Von der Dachpappe,
Fensterglas oder sonstigen
Materialien, zur notdürftigen
Reparatur der Häuser, war gegen
"Naturalien" alles zu
organisieren. Zigaretten waren
als "Zahlungsmittel" anerkannt.
Vor dem Hauptbahnhof in Koblenz
war täglich "Markt". Hunderte
tummelten sich hier um ihre
Geschäfte abzuwickeln. Die im
Wiederaufbau befindlichen
Behörden versuchten das Treiben
zu unterbinden, aber alle Mühen
waren vergebens. Es fehlte hinten
und vorne an Personal, die das
illegale Treiben hätte
unterbinden können. Die
Amerikaner sahen zunächst eher
uninteressiert zu. Hamsterfahrten
in das Umland der Städte waren
die einzige Chance zu überleben
und die Hungersnot einigermassen
zu überstehen. Tafelsilber und
Güter des gehobenen Bedarfs
wechselten gegen Lebensmittel den
Besitzer. Auch in Handwerk,
Handel und Industrie wurde
getauscht was das Zeug hielt. So
konnte eine prosperierende
Wirtschaft nicht aufgebaut
werden. Durch die ansteigenden
Spannungen der Westmächte
gegenüber dem Ostblock führten ab
1.1. 1947 in der Bizone (engl.
amerikan. Besatzungszone) zu
einer eigenständigen
Wirtschaftspolitik, die auf
amerikanische Initiative das ERP
Programm (European Recovery
Program) ins Leben rief. Um einen
Aufschwung der Wirtschaft zu
ermöglichen, mußten
Tauschwirtschaft, Schwarzmarkt
und die massive Entwertung der
Reichsmark beseitigt werden. Von
den Westalliierten war hierzu ein
harter Schnitt geplant, die
Währungsreform. Als im März 1948
die drei Westzonen zum
einheitlichen Wirtschaftsgebiet
zusammengefaßt wurden (Trizone),
war zu einer neuen Währung der
Weg frei. Die Bedingungen dieser
Umstellung wurden unter strenger
Geheimhaltung von amerikanischer
und britischer Seite bestimmt,
der Einfluß der deutschen
Wirtschaftsexperten war eher
gering. Trotz aller Geheimhaltung
kursierten in der Bevölkerung
viele Gerüchte über Einzelheiten
dieser Reform und vor allen
Dingen auch über deren Zeitpunkt,
Die Ahnungen und Vermutungen
führten zu einem völligen
Vertrauensverlust gegenüber der
alten RM-Währung, Waren wurden
zurückgehalten, die
wirtschaftliche Lage verschärfte
sich rapide und erhöhte den Druck
auf die westlichen
Besatzungsmächte, den Termin für
die Umstellung bekanntzugeben. Am
19. Juni 1948 war es dann soweit,
die Westalliierten gaben das
Währungsgesetz bekannt, und am
20. Juni 1948 wurde die neue
Währung ausgegeben: die
DM. Jeder Einwohner der
Trizone bekam 40 DM als Kopfgeld,
quasi als Startkapital.
Besitzer von Sparguthaben
wurden durch die Währungsreform
sehr stark benachteiligt, denn
die Konten wurden 10 zu 1
abgewertet, dagegen behielten
oder steigerten Immobilien oder
Sachwerte in kurzer Zeit ihren
Wert. Nach der Währungsreform
nahm Deutschlands Wirtschaft
einen rasanten Aufstieg, man
sprach vom "Deutschen
Wirtschaftswunder".
-
Zum
Seitenanfang
-
Die Franzosen
kommen
-
Koblenz und auch
Arenberg waren nur wenige Wochen
unter amerikanischer
Militärverwaltung, denn am 15
Juli 1945 rückten die Franzosen
mit Kind und Kegel in Koblenz ein
und lösten die Amerikaner ab.
Damit wurde aber auch die
"Entlausung" abgeschafft, aber
die "Amis" nahmen etwas später
ihre Pontonbrücke mit und Koblenz
war wieder ohne Rheinübergang.
Die G.I.`s waren satt, hatten
genug zu essen und wenn sie gut
gelaunt waren, fiel auch schon
mal eine Tafel Schokolade oder
ein Riegel Kaugummi oder sonstige
Süßigkeiten für die Kinder ab.
Die Franzosen hatten selbst
Hunger, von ihnen war nichts zu
erwarten, ganz im Gegenteil, sie
verschärften die Hungers- und
Wohnungsnot noch, wie folgende
überlieferte Story beweist: Ein
Koblenzer unterhielt in
Pfaffendorf einen Obstgarten und
hatte darin nachmittags ein
Körbchen Kirschen gepflückt. Ein
französischer Posten auf der
Pontonbrücke wollte die Kirschen
konfiszieren, der erboste
Koblenzer schüttete das kostbare
Obst lieber in den Rhein, als es
dem Franzosen zu überlassen.
Ebenso war es mit dem Wohnraum,
die Franzosen beschlagnahmten die
noch intakten Wohnungen für
Offiziere und leitendes Personal;
die Eigentümer wurden ausgewiesen
und in primitiven Notunterkünften
untergebracht. Politisch war
Frankreich dabei die Fehler des
Versailler
Vertrages zu wiederholen,
die letztlich zum 2. Weltkrieg
geführt hatten. Man wollte
Genugtuung, ja Rache nehmen für
den "Blitzkrieg" Hitlers, der in
nur drei Wochen Frankreich
besetzt hatte. La GRANDE NATION war beleidigt.
Diese
Politik änderte sich erst,
als auf Vorschlag des franz.
Aussenministers Robert
Schuman, die "Montanunion"
am 18.4.1951 und später die
"Euratom" 25.03.1957 in den
Pariser Verträgen gegründet wurde
und über die EG Verträge in die
heutige EU mündete. Die
herausragenden Politiker waren
damals Alcide de Gasperi
(Italien), Charles de Gaulle
(Frankreich), Konrad
Adenauer und nicht zu
vergessen
Robert Schuman, den "Vater
Europas", der schon sehr früh (9.5.1950 historische
Erklärung für die Neukonstruktion Europas)
und als erster
die
Vision eines Vereinigten Europas
hatte.
Aber bald regte sich neuer
Lebensmut, die Schuttberge
mussten weg, sehr schnell waren
auf den Plätzen in Koblenz
Maschinen aus den Bimsgebieten
der Umgebung aufgestellt, die von
morgens bis abends aus dem
zerkleinerten Schutt mit
allerhand Getöse, Ziegelsteine
herstellten. Die wurden auch
dringend gebraucht, war doch
vieles instandzusetzen oder neu
aufzubauen. Das taten
die Franzosen recht ausgiebig,
das heutige
Max-von-Laue-Gymnasium, große
Teile des Asterstein (Innere
Führung etc.), in Metternich
entstand ein neuer
Stadtteil (Pollenfeld), der ausschließlich von
französischen Familien
bewohnt war.
-
Zum
Seitenanfang
-
-
Mein erstes
Radio
-
Wie schon
berichtet war nach dem Krieg in Arenberg und
auch in Koblenz die
Stromversorgung
zusammengebrochen. Die
Abhängigkeit der Bürger von der
Stromversorgung war damals bei
weitem nicht so groß wie
heutzutage. Licht und Radio
konnte man schon missen, gekocht
wurde auf alten, mit Holz
befeuerten Herden, Kohlen oder
Briketts gab es auch keine. Licht
wurde mit Kerzen oder mit
Ölfunzeln aus dem vergangenen
Jahrhundert gemacht. Es gab auch
keine Zeitung und keine
Information. Informationsnotstand
sozusagen. Ein Radio musste her,
aber wie? Hier kam mir der Zufall
der letzten Kriegwochen entgegen.
Ein zweimotoriger Bomber der
US-Air-Forces (vermutlich eine
Dakota) war abgeschossen worden
und in der Nähe des
Mühlenbacherhofes abgestürzt.
Alles wurde von der Bevölkerung
irgendwie verwertet und
ausgeschlachtet. Der Kerosintank
verwandelte sich in Schuhsohlen,
an der Funkanlage hatte gottlob
niemand Interesse. Auch die
Kopfhörerkappe des Bordfunkers,
aus feinem Leder und innen mit
Fell gefüttert, wollt ausser mir
niemand haben. Mit einem kleinen
Handwagen fuhr ich die "Beute"
nach Hause. Die Drehkondensatoren
des Funkgerätes hatten es mir
angetan und wurden kurzerhand
ausgebaut. Um ein Miniradio zu
bauen, brauchte ich nur noch eine
selbstgewickelte (Hochfrequenz)
Spule, eine Langdrahtantenne, ein
paar Kondensatoren und einen
Detektorkristall. Die
Kondensatoren waren zuhauf im
Funkgerät. Den Detektorkristall*
suchte ich auf der Abraumhalde
der Grube Mühlenbach auf dem
Kissel, wo Bleiglanz (PbS) zu
finden war. Nach einigen
Versuchen gab mein Radio in
höchster (Ton) Qualität die
ersten Töne von sich. Aber ausser
AFN (American Forces Network,
Frankfurt) und dem BBC (British
Broadcasting Corporation, London)
gab mein Radio zunächst nichts
her.
-
-
*
Detektorkristall (Metallsulfid
mit Halbleitereigenschaften,
Gleichrichter)
-
Zum
Seitenanfang
-
Schnapsbrennen in
Arenberg
-
Es
ist ein Brauch von alters her,
wer Sorgen hat, hat auch Likör.
Dieser schon sprichwörtlich
gewordene Reim Wilhelm Buschs
hatte nach wie vor seine
Gültigkeit. In den Notzeiten nach
dem Krieg hatte man Sorgen, aber
dummerweise keinen Likör. Von der
Kreativität der Bevölkerung war
schon mehrfach die Rede - unser
Nachbar Aloys Girmann bewies
diese mit Bravour. Aloys war
Schmied und Schlossermeister.
Seine Schmiedewerkstatt lag
direkt gegenüber unserem
Bauernhof. Aloys war noch zum
"Volkssturm", dem letzten
Aufgebot der Nazis eingezogen
worden und war zu diesem
Zeitpunkt, als sich die folgende
Geschichte ereignete, gerade erst
vor einigen Tagen aus der
Kriegsgefangenschaft
zurückgekommen. Er funktionierte
eine ausrangierte Milchkanne mit
Bügelverschluß zur "Destille" um
und begann mit dem Schnapsbrennen
in seiner Küche. Dummerweise
hatte die blubbernde Maische den
Dampfaustritt verstopft, weil die
Kanne zu hoch aufgefüllt war. Es
kam wie es kommen muß, die
Destille explodierte unter einem
lauten Knall und verursachte
wüste Zerstörungen. Die Maische
hatte sich, wie bei Explosionen
üblich, kugelförmig im Raum
verteilt. Dementsprechend sah die
Küche aus, die Küchentüre und das
Fenster hatten auch stark
gelitten. Echte Kerle geben nach
anfänglichen Misserfolgen nicht
auf, denn bekanntlich führt nur
Beharrlichkeit zum Ziel, so
dachte auch Aloys. Teile des
ersten Versuches, so die
Kühlschlange und das Kühlgefäß
waren noch verwendbar und siehe
da, in einigen Tagen konnte der
zweite Versuch starten. Dieser
konnte aber nicht mehr in Aloys
Küche stattfinden, weil seine
Frau Änni und seine
Schwiegermutter entschieden gegen
weitere diesbezügliche Versuche
waren. Sie drohten auszuziehen.
Um es kurz zu machen: Der zweite
Brand fand dann bei Webers statt.
Das Ungetüm wurde mit reifer,
gärender Pflaumenmaische befüllt
und nun konnte die Anlage
befeuert werden. Nach einiger
Zeit gurgelte und gluckste die
Maische und siehe da, aus der
Kühlschlange tröpfelten
tatsächlich die ersten
Schnapstropfen. Jeder durfte zum
probieren mal seinen Finger
drunterhalten und abschlecken. Na
ja, für den ersten Brand schon
ganz vielversprechend. Das viele
"Probieren" hellte die Minen und
die Stimmung in unserer Küche
merklich auf. Mit der
Zeit wurden Aloys und mein Vater
wahre Meister der Brennzunft. Es
wurden Brände aus Mirabellen,
Äpfeln und Pflaumen ausprobiert
und hergestellt. Bald stellte
sich heraus, daß man zweimal
brennen mußte, damit das Ergebnis
klarer und hochprozentiger wurde.
Es war wie im richtigen Leben:
Übung macht den Meister. Reinhard
Potter erzählte mir, daß auch
sein Großvater die Explosion
einer selbstgebastelten Destille
überstanden hat. Die Sache war
natürlich behördlicherseits
streng verboten. Trotzdem lag in
Arenberg und anderswo immer
öfter ein Hauch würzigen
Alkoholdufts in der Luft.
Zum Seitenanfang
-
Pflanzkartoffeln aus der
Pellenz
-
Auch noch ein Jahr
nach Kriegsende (1946) war
bittere Hungersnot hierzulande.
Mein Vater, mein älterer Bruder
Paul und ich besorgten im
Frühjahr ca. 35 Zentner
Pflanzkartoffeln aus der
Pellenz.* Den Ort habe ich
vergessen, nicht aber die
Umstände des Kartoffeltransports.
Es war spät geworden, als wir an
der Fähre nach Ehrenbreitstein
mit unserer Fuhre ankamen. Wie
weiter oben schon angemerkt,
hatten "die Amis" die
Pontonbrücke bei ihrem Abzug aus
Koblenz mitgenommen. Die
Franzosen hatten ein unzerstörtes
Teilstück der alten Schiffbrücke
in eine Fähre umfunktioniert,
indem einfach ein kleines Schiff
fest mit der Fähre verzurrt war.
Dieses abenteuerliche Gefährt,
nicht vom TüV abgenommen,
pendelte tagsüber zwischen
Koblenz und Ehrenbreitstein hin
und her, mit Fuhrwerken und
Lastwagen durfte die Fähre aber
nur bis 18 Uhr benutzt werden.
Wir kamen etwa 20 Minuten später
an, aber der wachhabende Franzose
war durch nichts zu bewegen, uns
mit unserer Fuhre überzusetzen.
Wir fuhren den Wagen etwas zurück
in Richtung Kastorkirche am
Rheinufer, in die Nähe der
Winninger Weinstube. Mein Vater
spannte die Pferde aus, und zog
mit ihnen über die Fähre
heimwärts. Er ließ meinen Bruder
Paul und mich zurück mit der
ernsten Ermahnung, den Wagen in
der Nacht nicht aus den Augen zu
lassen. Kurz gesagt: Es war eine
lange und kalte Nacht, darauf
waren wir nicht vorbereitet.
Nichts zu essen und zu trinken,
keine Decke zum Aufwärmen, nichts
außer Kartoffeln - und die mußten
gegen eine hungernde Bevölkerung
bewacht werden. Nach des Tages
Mühen - etwa 50 km mit dem
Pferdefuhrwerk und 35 Zentner
Kartoffeln aufladen - waren wir
beide rechtschaffen müde. Nach
Einbruch der Dunkelheit wurde es
immer schwerer, uns wach zu
halten. Wir erfanden das
Intervallschlafen, einer rannte
in großem Bogen um den Wagen, der
andere versuchte trotz Kälte und
knurrendem Magen etwas zu
schlafen. So ging das im
halbstündigen Wechsel bis zum
Morgengrauen. Die Geräusche in
der Nacht waren auch nicht
angetan, um in uns ein Gefühl der
Geborgenheit aufkommen zu lassen.
Der Rhein gluckste und
plätscherte und aus der
Ferne schrie ein Käuzchen, es war
unheimlich. Dauernd spähten wir
in die Dunkelheit, ob sich jemand
in eindeutiger Absicht unseren
Kartoffeln nähern wollte. Gegen
einen massiven Übergriff mehrerer
Personen wären wir Halbwüchsigen
ohnehin machtlos gewesen. Aber
die Nacht blieb zumindest unter
diesem Aspekt ruhig. Gegen neun
Uhr konnte ich am
Ehrenbreitsteiner Ufer unsere
Pferde ausmachen, die von meinem
Vater auf die Fähre geführt
wurden. Vater hatte warmen Kaffee
und Verpflegung mitgebracht. Die
Pflanzkartoffeln haben wir gut
nach Arenberg und später in die
Erde gebracht, aber auch dort
waren sie vor der hungernden
Bevölkerung nicht sicher. In
vielen Orten waren tagsüber
"Flurhüter" eingesetzt um die
ausgebrachte Saat oder die Ernte
vor Plünderung zu schützen. Aber
eben nur tagsüber, in den
Nachtstunden mussten wir Kinder
die Felder bewachen, bis das
erste Grün aus den Pflanzreihen
sproß. Trotz alledem wurden
Pflanzkartoffeln nächtens wieder
ausgegraben. Wo geplündert worden
war, sah man erst Wochen später,
wenn kahle Reihen aus dem
Kartoffel-Grün
hervortraten.
-
*
Die Pellenz, so wird die Gegend
um Polch und Münstermaifeld in
der Eifel genannt.
-
Zum
Seitenanfang
-
Beim
Apfelpflücken
-
1945, im
drückendsten Hungerjahr nach dem
Krieg, hatten wir etwa 2000
Zentner Äpfel zu ernten. Diese
wurden gepflückt und nicht,
 wie heutzutage,
geschüttelt. Es war ein
sogenanntes Mastjahr. Bucheckern,
Pflaumen und sonstige Früchte gab
es zuhauf und im Überfluss.
Fallobst wurde sofort aufgelesen,
Szenen wie auf dem Foto
waren undenkbar.
Mit langen Leitern fuhr mich mein
Vater frühmorgens auf den
Meisengraben, ließ mir den mit
Stroh ausgepolsterten Wagen
stehen und empfahl sich mitsamt
den Pferden. Im Weggehen hörte
ich ihn noch sagen: "Heute Abend
hole ich dich ab, zu essen ist ja
genug da". Ich pflückte Korb um
Korb. Gegen 16:30 war der Wagen
gehäuft voll und ich hatte zwei
oder drei Bäume abgeerntet.
Jeder, der das schon einmal
gemacht hat weiß, unter dem Baum
liegt allerhand Fallobst. Dieses
wurde in Säcke gefüllt und zu
Kompott oder Trockenobst
(Apfelringe) verarbeitet. Es
durfte halt nichts
verkommen. wie heutzutage,
geschüttelt. Es war ein
sogenanntes Mastjahr. Bucheckern,
Pflaumen und sonstige Früchte gab
es zuhauf und im Überfluss.
Fallobst wurde sofort aufgelesen,
Szenen wie auf dem Foto
waren undenkbar.
Mit langen Leitern fuhr mich mein
Vater frühmorgens auf den
Meisengraben, ließ mir den mit
Stroh ausgepolsterten Wagen
stehen und empfahl sich mitsamt
den Pferden. Im Weggehen hörte
ich ihn noch sagen: "Heute Abend
hole ich dich ab, zu essen ist ja
genug da". Ich pflückte Korb um
Korb. Gegen 16:30 war der Wagen
gehäuft voll und ich hatte zwei
oder drei Bäume abgeerntet.
Jeder, der das schon einmal
gemacht hat weiß, unter dem Baum
liegt allerhand Fallobst. Dieses
wurde in Säcke gefüllt und zu
Kompott oder Trockenobst
(Apfelringe) verarbeitet. Es
durfte halt nichts
verkommen.
-
Weit unten aus der
Eselsbach sah ich eine
Menschenmenge den Berg
hochkraxeln, die alle ein festes
Ziel vor Augen hatten. Mir
schwante nichts Gutes. Sie kamen
immer näher und als sie den
vollen Wagen mit den Äpfeln
sichteten, wurden sie immer
schneller und rannten schließlich
auf mich zu. Binnen weniger
Minuten war mein Wagen geplündert
- vor Hunger in den Apfel beissen
und mitgebrachte Taschen und
Rucksäcke vollstopfen geschah
gleichzeitig. Das Fallobst
interessierte sie nicht, das
ließen sie mir gnädigst liegen.
Ich hatte Glück in meinem Unglück denn oben
am Feldweg sah ich meinen Vater
mit den Pferden kommen. Er wurde
auch von den Koblenzer Frauen
 gesichtet, so schnell sie
gekommen waren, so schnell waren
sie auch verschwunden. Jetzt aber
war mein Wagen leer. Ein
Donnerwetter blieb mir erspart,
Vater hatte alles mitangesehen
und in der Folge mußte ich nie
mehr alleine Äpfel
pflücken. gesichtet, so schnell sie
gekommen waren, so schnell waren
sie auch verschwunden. Jetzt aber
war mein Wagen leer. Ein
Donnerwetter blieb mir erspart,
Vater hatte alles mitangesehen
und in der Folge mußte ich nie
mehr alleine Äpfel
pflücken.
-
Aber die ganze
Sache hatte für mich auch einen
freundlichen Aspekt, denn unter
den Frauen fiel mir eine ganz
besonders auf. Sie hatte
offensichtlich bessere Tage
gesehen, hierhin hatten sie
Hunger und Not getrieben. Sie war
mit einer Kittelschürze bekleidet
und trug ein Kopftuch, das unter
dem Kinn verknotet war. Ich
verfolgte sie mit meinen Augen,
sie war etwa doppelt so alt wie
ich und als sie mich gewahrte,
richtete sie sich auf und kam,
das Kopftuch lösend auf mich zu,
fasste mich an den Schultern und
küßte mich auf die Wange, so, als
wolle sie sich für den Diebstahl
der Äpfel entschuldigen und
gleichzeitig bedanken.
Im Dreieck
zwischen Kuhstall, Pferdestall
und Apfelpflücken wurden wir
nicht gerade mit Zärtlichkeiten
überhäuft. Der Kuß einer schönen
Frau, wie sie Sandro Botticelli
oder Michelangelo nicht
schöner hätten malen können,
beeindruckte mich doch sehr. Sie
war eine Schönheit mit schwarzem
Haar, vom Typ her Römerin mit
dunklen Augen, wie man sie an
Rhein und Mosel oft sehen kann,
Nachfahren der römischen
Besatzung vor 2000 Jahren. Sie
ging mit den anderen Frauen weg,
ohne auch nur ein Wort des
Abschieds zu sagen. Um es
vorwegzunehmen, wir begegneten
uns Jahre später wieder, doch
unter ganz anderen Umständen.
Aber der Reihe nach: Anfang der
1950 Jahre lernte ich durch
Zufall einen kanadischen Offizier
kennen, im Zivilberuf Studienrat,
er glaubte in mir einen im Krieg
vermißten Freund wiederzuerkennen.
Hierin mußte ich ihn leider
enttäuschen, aber es bot sich nun
für mich eine gute Gelegenheit
meine französischen Sprachkenntnisse aufzubessern. Er war
Verbindungsoffizier zu französischen
Dienststellen der Besatzung in
Koblenz und wohnte längere Zeit
in Koblenz in der Kornpfortstraße. Sein Name war Tom
Paddington. Wir trafen uns öfter
und ich zeigte ihm die vom Krieg
noch verbliebenen
Sehenswürdigkeiten von Koblenz
und die Arenberger Kirche und Anlagen. Im
Sommer wurde auf der Rheinlache
(Foto links) die Johann Strauss
Operette "Eine Nacht in Venedig"
mit dem unvergessenen Tenor und
Kammersänger Christo Bajew
aufgeführt, ein Augen- und
Ohrenschmaus erster Güte. Tom und
ich besorgten uns also Karten und
gingen abends erwartungsvoll zur
Vorstellung. Wir waren viel zu
früh dran und suchten uns einen
günstigen Platz in der Mitte,
direkt gegenüber der Bühne aus.
Kurz vor Beginn der Vorstellung
kam SIE, die Schöne vom
Meisengraben, diesmal nicht in
Kittelschürze. Wir erkannten uns
sofort, sie meinte nach kurzer
Begrüßung, mir in der Pause noch
eine Erklärung schuldig zu sein.
Die Vorstellung begann und
Christo Bajew, (Foto) mit seinem
einschmeichelnden lyrischen Tenor sang
die Glanzarie: "Steig in die
Gondel mein Liebchen ich lade
dich ein" das Publikum war
hingerissen, es gab
Szenenapplaus, Anfang der
1950 Jahre lernte ich durch
Zufall einen kanadischen Offizier
kennen, im Zivilberuf Studienrat,
er glaubte in mir einen im Krieg
vermißten Freund wiederzuerkennen.
Hierin mußte ich ihn leider
enttäuschen, aber es bot sich nun
für mich eine gute Gelegenheit
meine französischen Sprachkenntnisse aufzubessern. Er war
Verbindungsoffizier zu französischen
Dienststellen der Besatzung in
Koblenz und wohnte längere Zeit
in Koblenz in der Kornpfortstraße. Sein Name war Tom
Paddington. Wir trafen uns öfter
und ich zeigte ihm die vom Krieg
noch verbliebenen
Sehenswürdigkeiten von Koblenz
und die Arenberger Kirche und Anlagen. Im
Sommer wurde auf der Rheinlache
(Foto links) die Johann Strauss
Operette "Eine Nacht in Venedig"
mit dem unvergessenen Tenor und
Kammersänger Christo Bajew
aufgeführt, ein Augen- und
Ohrenschmaus erster Güte. Tom und
ich besorgten uns also Karten und
gingen abends erwartungsvoll zur
Vorstellung. Wir waren viel zu
früh dran und suchten uns einen
günstigen Platz in der Mitte,
direkt gegenüber der Bühne aus.
Kurz vor Beginn der Vorstellung
kam SIE, die Schöne vom
Meisengraben, diesmal nicht in
Kittelschürze. Wir erkannten uns
sofort, sie meinte nach kurzer
Begrüßung, mir in der Pause noch
eine Erklärung schuldig zu sein.
Die Vorstellung begann und
Christo Bajew, (Foto) mit seinem
einschmeichelnden lyrischen Tenor sang
die Glanzarie: "Steig in die
Gondel mein Liebchen ich lade
dich ein" das Publikum war
hingerissen, es gab
Szenenapplaus, 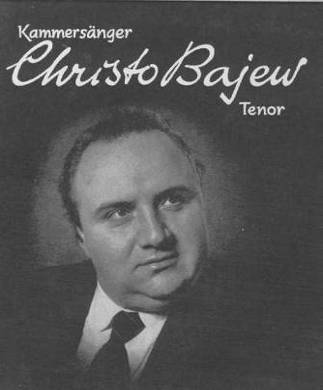 selbst auf der
anderen Rheinseite, am
Pfaffendorfer Ufer, standen viele
Zaungäste und klatschten
begeistert mit. Das Ambiente, die
laue Sommernacht, ein
vorzügliches Orchester und
begeisternde Künstler auf der
Bühne ließen diese Vorstellung
zum unvergesslichen Erlebnis
werden. In der Pause
nahmen wir eine Erfrischung, Tom
hatte eingeladen und sie
erzählte, mehr zur
Entschuldigung, ihre Geschichte:
Sie war in Koblenz total
ausgebombt worden und hatte alles
verloren, nicht mal
Erinnerungsfotos seien ihr
geblieben, ihr Mann,
Bauingenieur, war im Krieg bei
Stalingrad (heute Wolgograd)
gefallen und sie war bei
Bekannten vorübergehend
untergekommen. Aber, so fuhr sie
fort, da könne sie auf Dauer
nicht bleiben. Hin und wieder
musste ich Tom ihre Geschichte
übersetzten.- Eine Geschichte und
ein Schicksal, wie es sich im
Krieg tausendfach
zugetragen und hätte erzählt
werden können. Tom versprach ihr
zu helfen und ich denke, das hat
er auch getan. selbst auf der
anderen Rheinseite, am
Pfaffendorfer Ufer, standen viele
Zaungäste und klatschten
begeistert mit. Das Ambiente, die
laue Sommernacht, ein
vorzügliches Orchester und
begeisternde Künstler auf der
Bühne ließen diese Vorstellung
zum unvergesslichen Erlebnis
werden. In der Pause
nahmen wir eine Erfrischung, Tom
hatte eingeladen und sie
erzählte, mehr zur
Entschuldigung, ihre Geschichte:
Sie war in Koblenz total
ausgebombt worden und hatte alles
verloren, nicht mal
Erinnerungsfotos seien ihr
geblieben, ihr Mann,
Bauingenieur, war im Krieg bei
Stalingrad (heute Wolgograd)
gefallen und sie war bei
Bekannten vorübergehend
untergekommen. Aber, so fuhr sie
fort, da könne sie auf Dauer
nicht bleiben. Hin und wieder
musste ich Tom ihre Geschichte
übersetzten.- Eine Geschichte und
ein Schicksal, wie es sich im
Krieg tausendfach
zugetragen und hätte erzählt
werden können. Tom versprach ihr
zu helfen und ich denke, das hat
er auch getan.
-
Nach diesem Abend
sah ich die "Schöne vom
Meisengraben" nicht mehr, es war
unsere letzte Begegnung. Tom ging
im folgenden Herbst nach Kanada
zurück, seine Militärzeit war zu
Ende, aber er wollte mich
unbedingt mit nach Toronto
nehmen. Über Jahre hinweg
pflegten wir regen Briefwechsel,
der leider mit zunehmender
beruflicher Beanspruchung
verebbte.
-
Zum Seitenanfang
-
Bucheckern, Retter in der
Hungersnot
-
Arenberger Frauen
waren mit Kind und Kegel und
jedem, der laufen und sich bücken
konnte, in den umliegenden
Buchenwäldern unterwegs. Um den
Hunger zu stillen, wurden
Bucheckern gesammelt, die wie in
"Mastjahren" üblich, zentnerweise
unter den Bäumen lagen. So auch
mein Bruder Ludolf und ich. Das
Ergebnis unserer Bemühungen war
eher kläglich und abends war der
Rücken krumm. Am nächsten Tag
besannen wir uns auf unsere fast
schon vergessene "Fochmühle", die
seit Jahren unbenuzt in einer
Ecke des Schuppens stand. Bevor
ich weiter erzähle, muß zuerst
die Funktion der Fochmühle
erklärt werden. Foch- kommt
etymologisch von fauchen oder
Windblasen. Die Fochmühle war ein
Instrument, das vordem, als es
noch keine Dreschmaschinen gab,
nach dem Flegeldreschen benutzt
wurde, um die Spreu im
sprichwörtlichen Sinn vom Weizen
zu trennen. Über ein Rüttelsieb
konnten zudem grobkörnige
Verunreinigungen entfernt werden.
Die Maschine wurde mit einer
Handkurbel angetrieben, hatte ein
eingebautes Windrad und oben
einen breiten Einfülltrichter, in
den das rohe Dreschgut
eingeschaufelt wurde. Mit diesem
altertümlichen Gerät, einer
breiten Schaufel und Besen
bewaffnet, gingen wir die Sache
an. Nachdem die passenden
Rüttelsiebe eingelegt waren,
stellte sich sehr schnell der
Erfolg unseres
Erfindungsreichtums ein. Wir
hatten abends kiloweise
Bucheckern, sogar in zwei Sorten,
Güteklasse A + B, aus denen nur
noch einige verbliebene
Holzstückchen aussortiert werden
mußten. In Oberlahnstein gab es
damals eine Ölmühle, die aus
Bucheckern oder Raps Öl
herstellte. Bei Anlieferung von
einem Zentner Bucheckern gab´s
etwa zwei Liter Öl, beim Raps war
der Ertrag etwas höher. Der
ausgepresste Ölkuchen wurde an
die Hühner und Gänse verfüttert,
die sich gierig darüber
hermachten. Das Rapsöl stank beim
Erhitzen und war eher eine
Zumutung für die
Geschmacksnerven. Das
Bucheckernöl dagegen war von weit
edlerem Geschmack und goldgelb in
der Farbe, vergleichbar mit
Sonnenblumen- oder
gelblich-grünem Olivenöl. Mit dem
Pferdefuhrwerk wurde die Ernte
vieler Arenberger Familien nach
Oberlahnstein verfrachtet, 10
Zentner und mehr und ebensoviele
Personen waren auf dem Wagen. Die
Fahrten erinnerten mehr an
fröhliche Landpartien, weil jeder
seine "Ernte" selbst abliefern
wollte und dafür sein kostbares
Öl bekam. In der Rückschau
auf die Hungerjahre fällt mir
auf, daß die Bevölkerung
insgesamt wesentlich gesünder als
heutzutage war. Adipositas
(Fettsucht) war ebenso unbekannt
wie Kreislauf- oder
Herzbeschwerden. Die Leute sahen
gleich aus, es gab keine "Dicke
oder Dünne" gleichsam wie eine
Herde Kühe auf der Weide, wo es
auch keine dünne und dicke gibt,
alle sind gleich gut (oder
schlecht) ernährt.
-
Zum
Seitenanfang
|